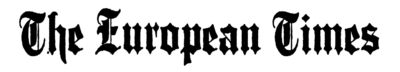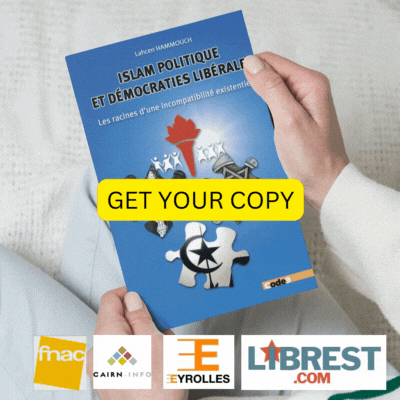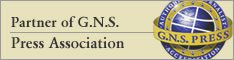Neue EU-Fiskalregeln von den Abgeordneten gebilligt
Fluggesellschaften werden aufgefordert, Asyltransfers zwischen Großbritannien und Ruanda nicht zu ermöglichen
Hier eine Auswahl an Artikeln, die zu einem höheren Bewusstsein der Gesellschaft beitragen können